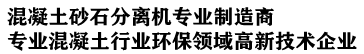服务热线
025-57263888

亚新官方网站(中国)亚新有限公司是一家专门从事搅拌站环保机械设备研究制造的专业公司,地处南京南郊,交通十分便利,注册资金580万元,厂区占地面积15000平米,拥有专业技术 人员与研究人员二十多人,并导入企业发展战略,规范化管理、人力资源管理、营销管理等企业管理体系以坚实的品质为各位新老客户提供更优质的服务! 多年来公司围绕着混凝土行业环保领域研究生产出一系列项目,并提供一站式全方位改造,其中包括沙石分离机系统、污水回收系统、压滤机、仓顶脉冲除尘器、料仓喷淋系统、工程车辆冲洗装置、室外喷雾桩、低压打料输送系统、搅拌楼钢结构外封等一系列服务。 南淮环保公司本着”为客户创造价值、为自身赢得荣誉“的理...
查看详情 >>产品展示
Products成功案例
case亚新官方网站(中国)亚新有限公司是一家专门从事搅拌站环保机械设备研究制造的专业公司,厂区占地面积15000平米,拥有专业技术 人员与研究人员二十多人,并导入企业发展战略,规范化管理、人力资源管理、营销管理等企业管理体系以坚实的品质为各位新老客户提供更优质的服务!...
亚新官方网站(中国)亚新有限公司是一家专门从事搅拌站环保机械设备研究制造的专业公司,厂区占地面积15000平米,拥有专业技术 人员与研究人员二十多人,并导入企业发展战略,规范化管理、人力资源管理、营销管理等企业管理体系以坚实的品质为各位新老客户提供更优质的服务!...
亚新官方网站(中国)亚新有限公司是一家专门从事搅拌站环保机械设备研究制造的专业公司,厂区占地面积15000平米,拥有专业技术 人员与研究人员二十多人,并导入企业发展战略,规范化管理、人力资源管理、营销管理等企业管理体系以坚实的品质为各位新老客户提供更优质的服务!...
亚新官方网站(中国)亚新有限公司是一家专门从事搅拌站环保机械设备研究制造的专业公司,厂区占地面积15000平米,拥有专业技术 人员与研究人员二十多人,并导入企业发展战略,规范化管理、人力资源管理、营销管理等企业管理体系以坚实的品质为各位新老客户提供更优质的服务!...
亚新官方网站(中国)亚新有限公司是一家专门从事搅拌站环保机械设备研究制造的专业公司,厂区占地面积15000平米,拥有专业技术 人员与研究人员二十多人,并导入企业发展战略,规范化管理、人力资源管理、营销管理等企业管理体系以坚实的品质为各位新老客户提供更优质的服务!...
亚新官方网站(中国)亚新有限公司是一家专门从事搅拌站环保机械设备研究制造的专业公司,厂区占地面积15000平米,拥有专业技术 人员与研究人员二十多人,并导入企业发展战略,规范化管理、人力资源管理、营销管理等企业管理体系以坚实的品质为各位新老客户提供更优质的服务!...
亚新官方网站(中国)亚新有限公司是一家专门从事搅拌站环保机械设备研究制造的专业公司,厂区占地面积15000平米,拥有专业技术 人员与研究人员二十多人,并导入企业发展战略,规范化管理、人力资源管理、营销管理等企业管理体系以坚实的品质为各位新老客户提供更优质的服务!...
亚新官方网站(中国)亚新有限公司是一家专门从事搅拌站环保机械设备研究制造的专业公司,厂区占地面积15000平米,拥有专业技术 人员与研究人员二十多人,并导入企业发展战略,规范化管理、人力资源管理、营销管理等企业管理体系以坚实的品质为各位新老客户提供更优质的服务!...
亚新官方网站(中国)亚新有限公司是一家专门从事搅拌站环保机械设备研究制造的专业公司,厂区占地面积15000平米,拥有专业技术 人员与研究人员二十多人,并导入企业发展战略,规范化管理、人力资源管理、营销管理等企业管理体系以坚实的品质为各位新老客户提供更优质的服务!...
新闻中心
NEWS INFORMATION我们的优势
我们秉承:以客户为中心,礼成守信的态度专业并极富创造力的团队
较先进的设备配套
严苛产品质检团队
获得各种业内荣誉证书
一对一服务,一分钟响应
好的服务是我们秉承的原则
质量保障,性价比高
价格合理、物超所值
如果您有任何问题,请跟我们联系!
联系我们
QQ:903818626 电话:025-57263888
地址:南京市溧水区石湫镇明觉光明经济区9号 EMAIL:njnh_2014@163.com
Copyright © 2020-2022亚新官方网站(中国)亚新有限公司 版权所有 苏ICP备14054489号-2 XML地图 网站模板